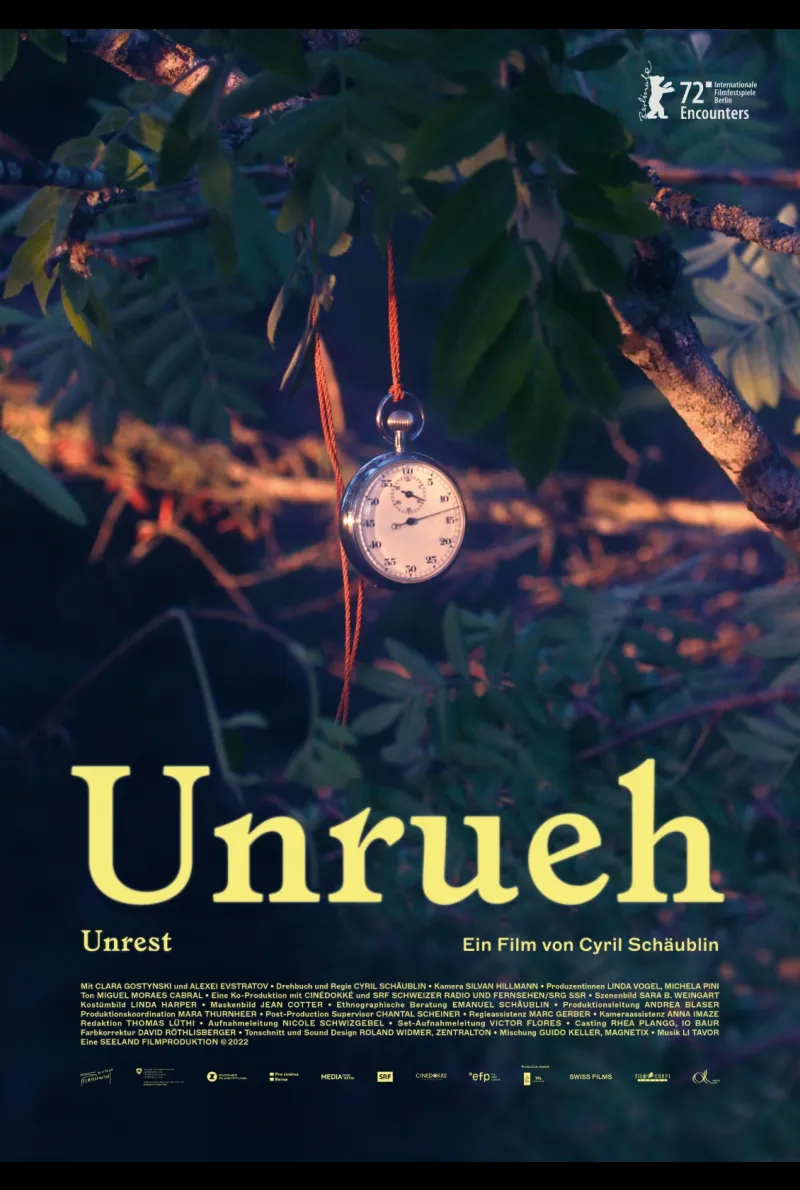Der mit Abstand grösste Luxusuhrenhersteller übernimmt Juwelier Bucherer, den weltgrössten Uhren- und Schmuckverkäufer. Bucherer verkaufte seit über 90 Jahren Rolex® Uhren und war mit geschätzten 1.7 Miliarden Schweizer Franken der wichtigste Umsatzträger des Luzerner Unternehmens.
Nach über 135 Jahren in Familienbesitz verschwindet ein weiterer Familienbetrieb. Der bald 90 jährige Jörg G. Bucherer, dessen Privatvermögen auf 2.5 Milliarden geschätzt wird, führte das Unternehmen in der 3. Generation, hatte aber keine interne Nachfolgeregelung gefunden.
Die Bucherer Gruppe führt neben der Filiale in Basel noch 16 weitere in der Schweiz, 10 in Deutschland, 6 in England, sowie in Kopenhagen, New York, Wien und Paris. Zur Gruppe gehört auch die Uhrenmarke Carl F. Bucherer. Die Firma soll zunächst weiterhin eigenständig agieren und die weltweit etwa 2’400 Mitarbeiter übernommen werden. Der Übernahmepreis ist nicht bekannt.
Weitere Infos ⬈ www.srf.ch/news
Falls die Zustimmung der Wettbewerbskommission erfolgt, was bedeutet dies für die bisherigen Rolex-Vertreter in der Schweiz, wie Spinnler + Schweizer in Basel, Zigerli Iff in Bern, Beyer in Zürich oder Wempe in Deutschland?
Wir werden sehen…
ROLEX® wurde 1920 vom Deutschen Hans Wilsdorf gegründet, ist heute auf den ganzen Welt in ca. 100 Ländern vertreten und hat 30 eigene Flagshipstores. Der Konzern beschäftigt aktuell weltweit etwa 14’000 Mitarbeitende, davon 9’000 in der Schweiz. Seit 2015 ist ⬈ Jean-Frédéric Dufour CEO des Konzerns mit Sitz in Genf. ⬈ Wikipedia
Rolex ist mit einem geschäzten Umatz von über 9 Miliarden die absolute Nummer 1, vor Cartier mit etwa 2.7 Mia., Omega 2.4 Mia, Audemars Piquet mit 2 und Patek Philippe mit ca. 1.8 Miliarden Umsatz. Etwa ein Viertel des Umsatzes der Schweizer Uhrenindustrie wird alleine durch Rolex umgesetzt.
Die günstigste Uhr im Sortiment kostet um die CHF 5’000 und das teuerste Model um CHF 100’000. Die bisher teuereste gebrauchte Rolex Uhr wurde 2017 für unglaubliche 17.8 Mio-Dollar ersteigert.
Hinweis: Alle Angaben in diesem Beitrag wurden sorgfältig recherchiert. Dennoch übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte.
Umsatzzahlen ⬈ Schweizer Handelszeitung